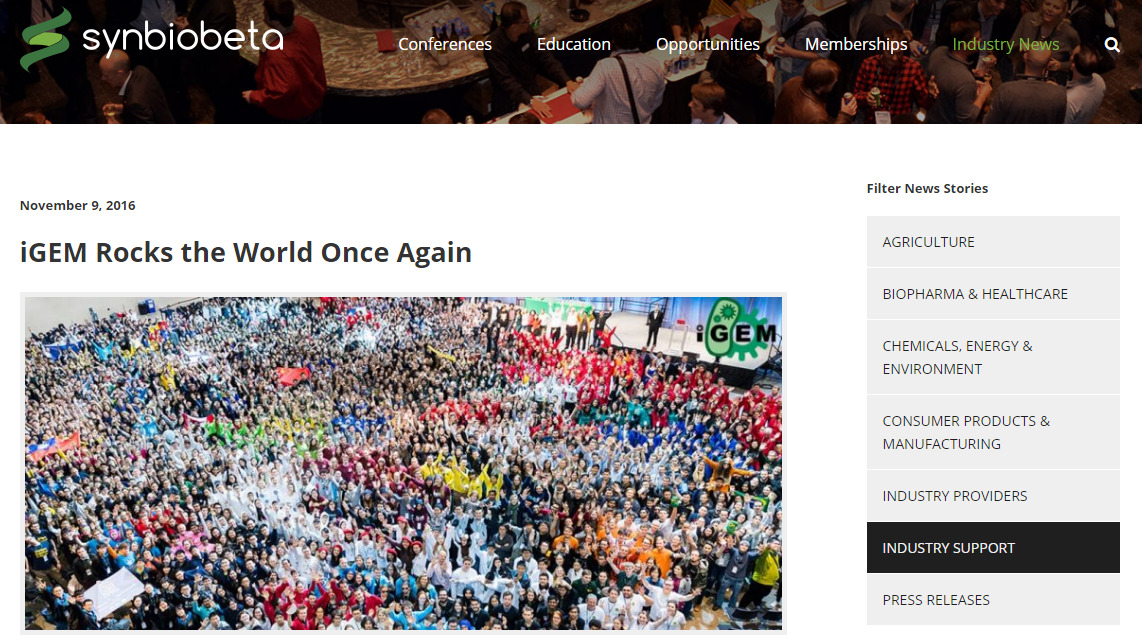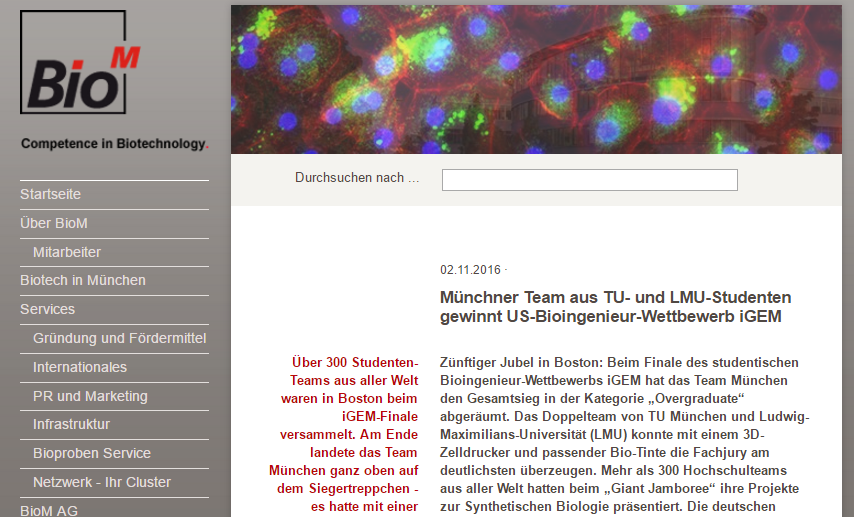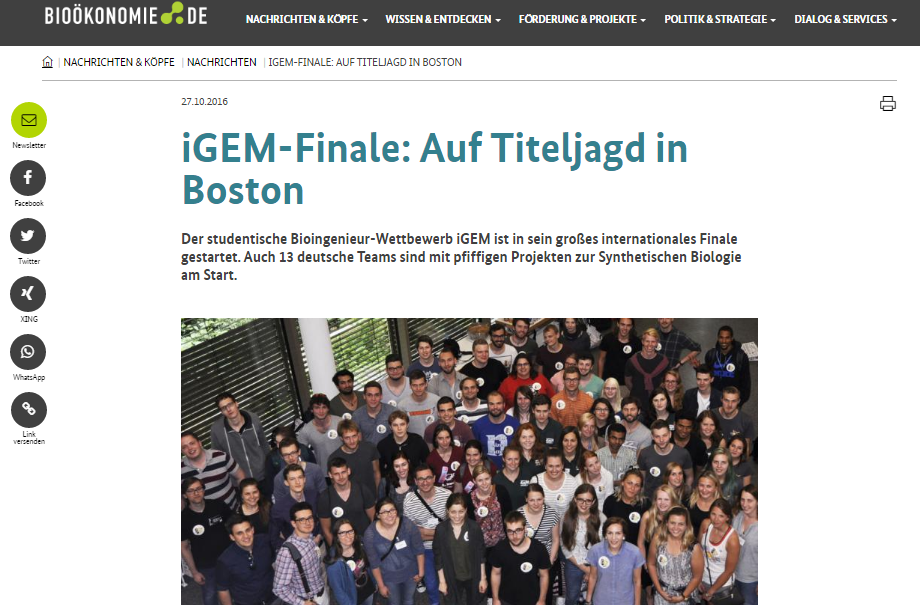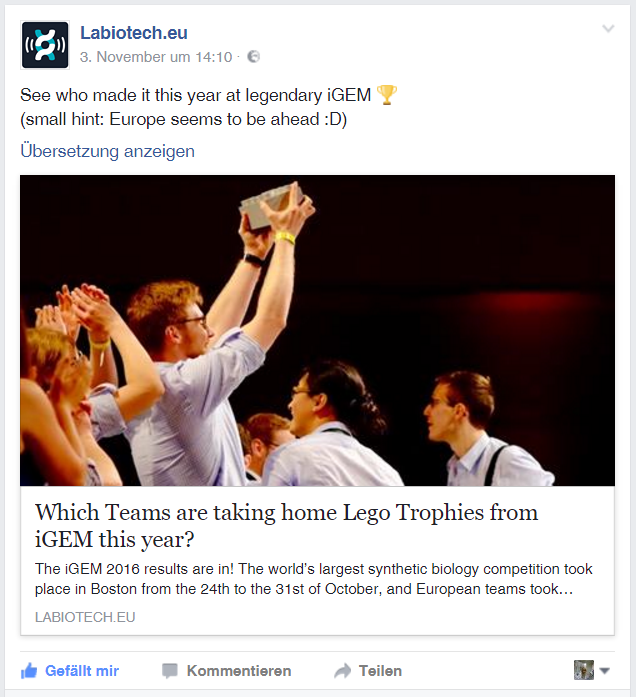Contents
German Radio
Deutschlandfunk: "Bio-Tinte fuer den Bio-3D-Drucker"
[http://www.deutschlandfunk.de/wissenschafts-wettbewerb-bio-tinte-fuer-den-bio-3d-drucker.676.de.html?dram:article_id=369777] File:Muc Deutschlandfunk.pdf
Bio-Tinte für den Bio-3D-Drucker
Jährlich zieht es tausende Studenten der Biologie, Biochemie und Biotechnologie nach Boston zur iGEM Competition, einem Wettbewerb für Biobastler. Unter den 300 Finalistenteams sind dieses Mal auch zwölf deutsche Mannschaften. Sie haben einen konventionellen Plastik-3D-Drucker zu einem 3D-Bioprinter umgebaut oder erforschen Krebstherapien. Von Michael Lange
Nur auf den ersten Blick ein gewöhnlicher Drucker. Der zweite Blick verrät: Gedruckt wird in drei Dimensionen. Und auch das ist noch nicht alles. Es handelt sich um einen Bio-Drucker, erklärt Luisa Krumwiede, Studierende im fünften Semester an der TU München: "Wir versuchen letztendlich Zellen, also Gewebe, mit einem 3D-Drucker zu drucken. Und dazu haben wir einen konventionellen Plastik-3D-Drucker umgebaut zu einem 3D-Bioprinter." Und so entsteht Schicht für Schicht, ganz langsam, ein biologisches Gewebe. Professionelle Gewebezüchter können das auch. Sie benutzen dazu allerdings Hydrogele. Das sind gelatineartige Gerüststrukturen, die den Zellen Halt geben. Die Studierenden vom iGEM-Team der beiden Münchener Universitäten verzichten darauf. Denn der Gerüstbau macht das Drucken aufwendig und kompliziert.
3D-Struktur aus lebenden Zellen
Sie haben stattdessen eine spezielle Bio-Tinte für den 3D-Druck entwickelt. Ein Bestandteil ist der Stoff Biotin, der auch als Vitamin B7 bekannt ist. Er soll in Kontakt mit den Zellen treten. Eine andere Substanz in der Bio-Tinte heißt Streptavidin. Das Protein bindet Biotin und funktioniert wie ein Klebstoff. Außerdem haben die Studierenden Zellen von Bakterien und Säugetieren so verändert, dass sie auf ihren Oberflächen spezielle Biotin-bindende Rezeptoren bilden, erklärt Krumwiede: "Das alles soll dann miteinander quervernetzen, da Streptavidin die Bindungsstellen für Biotin hat, und Biotin an unseren Rezeptor binden kann. Das soll dann polymerisieren und eine 3D-Struktur ausbilden." Der biotINK-Gewebedrucker druckt mit einer Kanüle Gewebe in eine kleine Petrischale (Andreas Heddergott/ TU München) Der biotINK-Gewebedrucker druckt mit einer Kanüle Gewebe in eine kleine Petrischale (Andreas Heddergott/ TU München) Aus Zellen und Bio-Tinte entsteht im 3D-Drucker ein Gewebe aus lebenden Zellen. Fertig für die Transplantation. Das Konzept klingt überzeugend, und so rechnet sich das iGEM-Team aus München selbstbewusst gute Chancen aus beim großen Finale in Boston. Luisa Krumwiede: "Also wenn ich nicht glauben würde, dass wir eine Chance hätten, dann würde ich auch gar nicht hinfahren."
Krebszellen durch Optogenetik ausschalten
Die Universität Düsseldorf ist zum ersten Mal mit einem Team am iGEM-Wettbewerb beteiligt. Die Initiative ging dabei von den Studierenden selbst aus. Ihre Internetseite verrät die großen Ambitionen: Stell dir vor, du drehst einen Schalter, und der Krebs ist weg. "Also uns ist aufgefallen, dass wir alle jemanden kennen, der von Krebs betroffen ist, und da haben wir uns überlegt, dass wir als Biologen da unbedingt etwas dran ändern sollten." Julian Ohl ist einer von 19 Studierenden, die am Projekt mitgearbeitet haben. Trotz wenig Laborerfahrung gelang es ihnen zwei hochaktuelle Forschungsrichtungen zu verknüpfen - mit dem Ziel, eine wirksame Krebstherapie mit möglichst wenigen Nebenwirkungen zu entwickeln: "Der Ansatz ist, dass wir uns optogenetischer Schalter bedienen. Das sind Proteine aus Pflanzen, die wir in den menschlichen Körper einbringen, und zwar gezielt in Krebszellen, und dort dann mit Licht bestrahlen. Das heißt wir benutzen Optogenetik, so heißt das Feld, wenn man mit Licht Proteine anschalten kann, und dadurch wird dann in Krebszellen gezielt der Zelltod eingeleitet."
Das Licht über Glasfaserkabel zum Krebs zu führen
Im Labor ging es zunächst darum, die optogenetischen Schalter in Zellen einzubauen. Sobald nun rotes Licht auf die Zellen trifft, entsteht ein Proteinkonstrukt, das den Zelltod auslösen kann. Anschließend muss noch blaues Licht hinzukommen. Es sorgt dafür, dass das Konstrukt zu den Mitochondrien gelangt. Erst dort kann es seine für Krebszellen tödliche Wirkung entfalten, erläutert Teammitglied Alina Kuklinski: "Unser jetziger Standpunkt ist, dass wir unsere Konstrukte gebaut haben - sowohl der rote als auch der blaue Lichtschalter. Unsere Konstrukte sind nun bereit, nach Boston geschickt zu werden." Noch nicht bei Krebs, aber in Zellkulturen mit Säugetierzellen haben die Studierenden das Prinzip erfolgreich getestet. Um es im menschlichen Körper einzusetzen, müssen das rote und das blaue Licht zum Krebs gelangen - zum Beispiel über feine Glasfaserkabel. Wissenschaftler arbeiten bereits an solchen Verfahren. Aber das ist nicht mehr Aufgabe des Düsseldorfer iGEM-Teams. Die Studierenden machen sich mit ihren Ergebnissen auf den Weg zum großen Finale nach Boston. "Jetzt wird noch einmal Vollgas gegeben. Und wir sind auf jeden Fall glücklich, was wir bereits erreicht haben", sagt Kuklinski."
Bayerischer Rundfunk: "Lebendes Gewebe aus dem 3-D-Drucker"
[http://www.br.de/mediathek/video/sendungen/nachrichten/skerra-drucker-medizin-100.html]
Websites
Synbiobeta.com: "iGEM Rocks the World Once Again"
[http://synbiobeta.com/news/igem-rocks-world/] File:Muc Synbiobeta.pdf
"This year, 273 teams coming from 6 continents attended the iGEM Giant Jamboree. The energy was electrifying as students buzzed around, setting up their posters, stressing about their presentations, and forging friendships across nationalities that will last a lifetime!
iGEM, for international Genetically Engineered Machine, is the premier global synthetic biology competition. Started in 2004, iGEM brings together teams of 2-20 students from across the world who spend the entire summer building a synthetic biology project that will save the world. These teams construct and assemble specific gene sequences called biobricks that code for particular traits into genetic circuits that cause the cell to perform some novel function.
A classic example is to create an arsenic biosensor by assembling the gene that detects arsenic with the gene that fluoresces and uploading that into the cell, so whenever the cell detects arsenic it will light up. Biosensors are just one example, however; these teams build projects that span the gamut of industries and applications, including within health, energy, architecture, and much more. All the iGEM tracks are listed here.
For 3 days straight, these teams are presenting their projects to a panel of 6 judges who will score them based on their presentation, their posters, and their wikis (the online repository of the team’s entire project). Every year, these projects become more robust, more creative, and more impressive. Furthermore, you start to see themes starting to emerge within the projects; in 2013, CRISPR was all the rage!
This year, however, I began to see a couple teams focusing on audiogenetics, or the ability to induce signal transduction using sound. Two teams, Slovenia and SUSTech Shenzhen, engineered proteins that detected pressure into the cell so that the cells could respond to ultrasound. Imagine delivering a payload of these cells into your bloodstream and being able to activate them in very specific regions of your body just by focusing an ultrasound on that particular region. This could become a powerful tool in targeted drug delivery.
The three winners for this year’s competition were HSi Taiwan for the High School track, Imperial College for the Undergraduate track, and LMU-TUM Munich for the Overgraduate track.
HSi Taiwan developed a test to determine the presence of toxins in traditional Chinese medicines. They recognized that because Chinese medicine fell somewhere between herbal supplements and actual medicine, it was a grey area for regulation and therefore the source and quality is not properly scrutinized. Not only did these high school students create sensors that could detect lead, copper, arsenic, and aflatoxin, but they also designed and built a physical device for the consumer to actually test their medicines, shown in the picture below.
Imperial College London worked on developing a communication system between cells, called quorum sensing, “to maintain stable coexistence of different cell types and allow the ratio of different populations to be stably maintained.” No biological process lives in isolation. Not only are cells able to sense their own growth and culture conditions, but they are inextricably intertwined with different species that make up their ecosystem. Take our microbiome, for example: a healthy microbiome contains a range of microbial species, however, those different species must maintain a proper ratio to be balanced. The ability to grow different populations of cells together will give us an insight in understanding how natural cellular systems work together, as well as allow us to build more complex systems and circuits.
Lastly, LMU-TUM Munich began to tackle the problem of an increasing organ shortage by building a 3D bioprinter with the goal of one day printing out organs de novo. The team repurposed an Ultimaker2 3D printer by building a new extrusion nozzle for it that can deliver a precise flow of liquid containing both the matrix and the cells. However, what made this team shine is not the printer that they built, but the approach they took to solve the scaffolding problem.
Currently, bioprinters rely on scaffolds to form the base on which cells are seeded. This presents many difficulties, including the need to assemble multiple 2D scaffolds to create a 3D object like an organ, then the subsequent dissolution of the scaffold to leave only the cells. This process makes 3D bioprinting cumbersome and expensive. Munich’s solution to this problem is to allow the cells to bind to each other immediately upon printing so that the cells themselves are structurally sound and are without need for a scaffold.
As a judge, I believe what made these projects extraordinary, and what earned them the title of iGEM World Champions, was not only their ambition, nor their progress on accomplishing that ambition (although that certainly counts for a lot). It was the thoroughness in which they completed the project; these teams included everything from hard-core mathematical modeling to an analysis of the impact of their project on the world. It was their clarity in presenting their complex projects. It was their competence when answering tough questions that judges threw at them.
This is my 5th year of participating in iGEM- 2 as a member, 1 as an advisor, and 2 as a judge- and I am proud to see this organization continue to excel at developing both the talent and the foundational repository of data necessary for the synthetic biology revolution.
The syringe pump is the main part of their printer extension. Its purpose is to deliver a precise and constant volume flow of liquid according to the printer's information.
By Shaun Moshasha| November 9th, 2016"
BioM Biotech Cluster Development
Press release with the text from biotechnologie.de (File:Muc BioM 001.pdf).
Biotechnologie.de
File:Muc Biotechnologiede 001.pdf
Team München: Mit Bio-Tinte zum iGEM-Champion 2016
"Am Ende landete das Team München ganz oben auf dem Siegertreppchen. Über 300 Studenten-Teams aus aller Welt waren in Boston beim iGEM-Finale versammelt. Am Ende landete das Team München ganz oben auf dem Siegertreppchen - es hatte mit einer Biotinte für einen Zell-3D-Drucker gepunktet.
Zünftiger Jubel in Boston: Beim Finale des studentischen Bioingenieur-Wettbewerbs iGEM hat das Team München den Gesamtsieg in der Kategorie „Overgraduate“ abgeräumt. Das Doppelteam von TU München und Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) konnte mit einem 3D-Zelldrucker und passender Bio-Tinte die Fachjury am deutlichsten überzeugen. Mehr als 300 Hochschulteams aus aller Welt hatten beim „Giant Jamboree“ ihre Projekte zur Synthetischen Biologie präsentiert. Die deutschen Teams kehren mit reichlich Medaillen und Titeln von dem Megaevent an der US-Ostküste zurück: Für die 13 hiesigen Teams gab es fünfmal Gold, sechsmal Silber und zweimal Bronze. Das Team Hamburg sahnte zudem den begehrten „iGEMers Prize“ ab, der von den Teilnehmern vergeben wird.
Damit geht die begehrte iGEM-Trophäe, der silberne Riesen-Legostein, wieder einmal nach Deutschland. In den vergangenen Jahren war insbesondere Team Heidelberg mit dem Double 2013 und 2014 bei der Bio-Konstrukteurs-WM in Boston das Maß der Dinge gewesen, in diesem Jahr waren die Badener jedoch nicht angetreten. Team München überzeugte in der Ü23-Kategorie diesmal auf ganzer Linie. Die Studierenden, traditionell mit Dirndl und Lederhosen auf der Bühne, hatten für einen 3D-Drucker eine neuartige Biotech-Tinte (biotINK) aus Zellen kreiert. Dank einer raffinierten molekularen Klebetechnik gelingt es damit, einfache Gewebestrukturen auf Oberflächen zu drucken.
Mit ihrem Projekt verwiesen die Münchener die enorme Konkurrenz auf die Plätze. Auf Rang zwei in der Gesamtwertung von iGEM landete das Team der Uni Wageningen mit einem Bienenschutzmittel gegen die Varroa-Milbe. Neben einer Goldmedaille heimste das TUM-LMU-Team auch noch Extra-Titel für „Best Hardware“, „Best Software“ und das „Best manufacturing project“ ein.
Londoner Team konstruiert Co-Kulturen
Auch in der Kategorie „Undergraduate“ (U23) war ein europäisches Team bei iGEM erfolgreich. Hier verbuchte das Team vom Imperial College London den Gesamtsieg für sich. Die Londoner haben sich in ihrem Projekt „Ecolibrium“ mit der Konstruktion von mikrobiellen Ökosystemen im Labor beschäftigt. Auf den Plätzen folgen das Team Sydney und SCAU-China.
Einen Sonderpreis heimste das Team Hamburg ein. Für die Hanseaten gab es den begehrten „iGEMers Prize“, der von den tausenden Teilnehmern des "Giant Jamborees" als Publikumspreis vergeben wird. Das Projekt "Finding Clamydory" - dessen Website-Gestaltung an den Kinoblockbuster "Finding Dory" angelehnt ist, traf offenkundig den Nerv des Plenums. Das Team hat einen Biosensor entwickelt, der Erreger der Art Chlamydia trachomatis gezielt aufspüren kann. Chlamydien sind Auslöser von Geschlechtskrankheiten, sie werden meist ungezielt mit Breitband-Antibiotika behandelt. Ein präzises Testverfahren, wie die Hanseaten es ausgetüftelt haben, könnte die Therapie verbessern.
Reichlich Edelmetall
Auch der Medaillenspiegel der deutschen Teams ist einmal mehr beeindruckend: Es gab fünfmal Gold (Aachen, Bielefeld, Düsseldorf, Freiburg und München), sechsmal Silber (Bonn, Darmstadt, Nürnberg-Erlangen, Göttingen, Hamburg und Marburg) und zweimal Bronze (Hannover und Tübingen). Damit haben die deutschen Hochschulteams die seit vielen Jahren äußerst erfolgreiche iGEM-Geschichte fortgeschrieben. Hier können Sie die Projekte der Saison 2016 im Kurzprofil nachlesen (mehr...). © biotechnologie.de/pg"
Biooekonomie.de - "iGEM-Finale: Auf Titeljagd in Boston"
File:Muc Biooekonomiede 001.pdf
"iGEM: Team München siegt mit Zell-Tinte
Triumph beim studentischen Bioingenieur-Wettbewerb iGEM in Boston: Das Team aus München hat mit seinem Zell-3D-Drucker den Gesamtsieg abgeräumt.
Riesen-Legostein nach München geholt
Die 13 deutschen Teams kehren mit reichlich Medaillen und Titeln von dem Megaevent an der US-Ostküste zurück: Für die hiesigen Teams gab es fünfmal Gold, sechsmal Silber und zweimal Bronze. Das Team Hamburg sahnte zudem den begehrten „iGEMers Prize“ ab, der von den Teilnehmern vergeben wird.
Damit geht die begehrte iGEM-Trophäe, der silberne Riesen-Legostein, wieder einmal nach Deutschland. In den Jahren 2013 und 2014 standen die iGEMer aus Heidelberg ganz oben auf dem Treppchen der akademischen "Bio-Konstrukteurs-WM". Team München überzeugte in der Ü23-Kategorie "Overgraduate" diesmal auf ganzer Linie. Die Studierenden, in Boston traditionell in Dirndl und Lederhosen unterwegs, hatten für einen 3D-Drucker eine neuartige Biotech-Tinte (biotINK) aus Zellen kreiert. Dank einer raffinierten molekularen Klebetechnik gelingt es damit, Zellen stabil und gezielt auf Oberflächen zu drucken und somit 3D-Gewebe herzustellen.
Mit ihrem Projekt verwiesen die Münchener die enorme Konkurrenz auf die Plätze. Auf Rang zwei in der Gesamtwertung von iGEM landete das Team der Uni Wageningen mit einem Bienenschutzmittel gegen die Varroa-Milbe. Neben einer Goldmedaille wurde das TUM-LMU-Team auch noch mit Sonderpreisen für „Best Hardware“, „Best Software“ und das „Best manufacturing project“ ausgezeichnet.
Hamburger Team wurde Publikumsliebling
Auch in der Kategorie „Undergraduate“ (U23) war ein europäisches Team bei iGEM erfolgreich. Hier verbuchte das Team vom Imperial College London den Gesamtsieg für sich. Die Londoner haben sich in ihrem Projekt „Ecolibrium“ mit der Konstruktion von mikrobiellen Ökosystemen im Labor beschäftigt. Auf den Plätzen folgen das Team Sydney und SCAU-China. Einen Sonderpreis heimste das Team Hamburg ein. Für die Hanseaten gab es den begehrten „iGEMers Prize“, der von den tausenden Teilnehmern des "Giant Jamboree" als Publikumspreis vergeben wird. Das Projekt "Finding Clamydory" - dessen Website-Gestaltung an den Kinoblockbuster "Finding Dory" angelehnt ist, war offenkundig ganz nach Geschmack des Plenums. Das Team hat einen Biosensor entwickelt, der Erreger der Art Chlamydia trachomatis gezielt aufspüren kann. Chlamydien sind Auslöser von Geschlechtskrankheiten, sie werden meist ungezielt mit Breitband-Antibiotika behandelt. Ein präzises Testverfahren, wie die Hanseaten es ausgetüftelt haben, könnte die Therapie verbessern.
Viel Edelmetall für die deutschen Teams
Auch der Medaillenspiegel der deutschen Teams ist einmal mehr beeindruckend: Es gab fünfmal Gold (Aachen, Bielefeld, Düsseldorf, Freiburg und München), sechsmal Silber (Bonn, Darmstadt, Nürnberg-Erlangen, Göttingen, Hamburg und Marburg) und zweimal Bronze (Hannover und Tübingen). Damit haben die deutschen Hochschulteams die seit vielen Jahren äußerst erfolgreiche iGEM-Geschichte fortgeschrieben. Hier kann man die Projekte aus der Saison 2016 im Kurzprofil nachlesen. pg"
Social Media
Facebook: SynBio.Info (22 500 followers)
Facebook: Labbiotech.eu (3 900 followers)